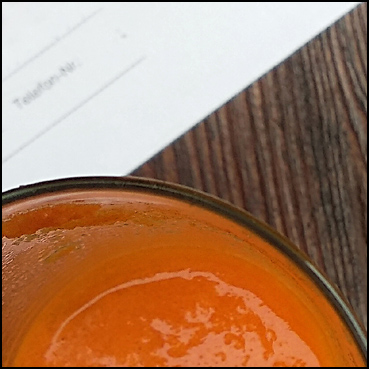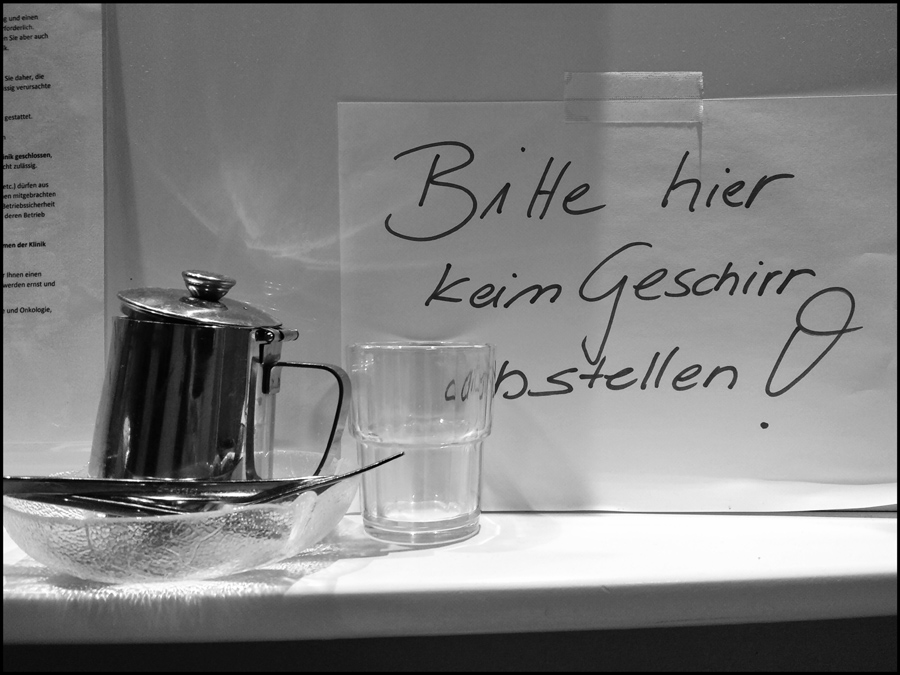Voll daneben ist auch vorbei
„Aber so war das doch nicht gemeint!“
Insa riss den linken Arm hoch in einer beschwichtigenden Abwehrbewegung, die Hand flach nach vorn gestreckt, als wollte sie Fabian wegdrücken. Oder streicheln. Es kam vermutlich darauf an, von welchem Blickwinkel aus man die Lage betrachtete, welchen Standpunkt man einnahm. Aber wie auch immer Insas Haltung zu deuten war und selbst wenn zutraf, dass sie nichts weiter als den Versuch darstellte, Fabian festzuhalten (was nicht zutraf), war es ohnehin zu spät: Fabian war längst fort. Er hatte sich umgedreht und war gegangen, wutschnaubend gegangen, wobei er wie so oft das letzte Wort behielt. Nicht einmal die winzige Zeitspanne, die es gebraucht hätte, um das Gesagte noch einmal darzulegen, mit anderen Worten, gönnte er ihr. Fabian ließ sie stehen und da stand sie nun. Insa senkte den Arm, der oben in der Luft keinen Zweck mehr erfüllte. Klatschend schlug ihre Hand auf den Oberschenkel, der Arm baumelte sinnlos daneben. Neben ihr, nicht an ihr. Da liegst du voll daneben mit dem Müll, den du redest!, hatte Fabian geschnaubt, als wäre immer sie diejenige, die alles falsch verstand, es in den falschen Hals bekam, wenn sie miteinander redeten. Insa kicherte. Was für eine Redewendung! Als besäßen Menschen zwei Hälse, in die die Worte hineinfielen, wo sie entweder in die eine oder in die andere Richtung rutschten, bei ihr natürlich grundsätzlich in die falsche, wovon Fabian auszugehen schien, womit er freilich selbst am weitesten daneben lag. Zu einem Gespräch gehörten schließlich immer zwei, sogar ein nüchterner Kopf, wie er Fabian auf seinen doppelten Hälsen baumelte, müsste das doch einsehen. Sie hätte es ihm gern gesagt, aber das ging nicht, er war ja bereits fort. Schon klar: Voll daneben ist eben auch vorbei.
Insa fand das verwunderlich, hatte sie doch stets geglaubt, man könne sich verständigen, wenn man es versuchte. Das Allerverwunderliche bestand freilich darin, dass Insa, lange nachdem sie sich von Fabian getrennt hatte und mit Luise zusammenlebte, genau das Gleiche sagen konnte wie einst zu Fabian und Luise es nie in den falschen Hals bekam, weder in den linken noch in den rechten noch sonst wohin. Fragte Insa dann einigermaßen verblüfft, ob Luise nicht dächte, sie läge wieder voll daneben oder redete Müll, wie Fabian es ihr vorgeworfen hatte, bekam Luise diesen unverständig-glasigen Gesichtsausdruck, bei dessen Anblick Insa umgehend begriff, dass sie solche Fragen, die letztlich nur dem Zweifel an ihr selbst entsprangen, künftig getrost bleiben lassen konnte. Denn wenn Luise auch sonst das meiste, wovon Insa sprach, augenblicklich verstand, für diese Art von Fragen – die Luise freilich als Selbstbezichtigungen bezeichnete – fehlte ihr schlichtweg das Verständnis. Du und ich, wir sind in den Worten unterwegs, sagte sie. Wie kannst du sie da für Müll halten, wo sie doch so wertvoll sind?
Das leuchtete Insa ein. Darum verfolgt sie seitdem eine Angewohnheit, weil sie es nicht vergessen will: Sie bringt die Flaschen, die sie leergetrunken hat, nicht zurück in den Laden, wo sie Pfand dafür bekommen könnte. Sie trägt sie in den Park und stellt sie neben die Mülltonnen, damit ein anderer sie findet, jemand, der größeren Nutzen davon hat. Denn eins ist ihr inzwischen klar geworden: Was dem einen als Müll erscheint, ist des anderen Schatz.
Manchmal denkt sie dann an Fabian. Aber nur selten. Und irgendwann vergisst sie ihn ganz.
(Dagmar Petrick)